|
T:-)M's Nachtwache Musikwelten, Weltmusik? |

|
FolkWorld Ausgabe 43 11/2010; Buchrezensionen von Walkin' T:-)M
|
T:-)M's Nachtwache Musikwelten, Weltmusik? |

|
Kennen Sie den schon? Ein Flugzeug aus Moskau landet mit jüdischen Emigranten auf dem Düsseldorfer Flughafen. 90% der Reisenden halten eine Geige, eine Flöte oder ein Cello in der Hand. Wenige kommen mit leeren Händen. Das sind die Pianisten.
|
|
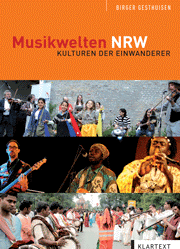 Birger Gesthuisen, Musikwelten NRW - Kulturen der Einwanderer. Klartext, 2010, ISBN 978-3-8375-0167-4, 339 S, €19,95 (inkl. CD). |
Um dies ein wenig mehr ins Bewusstsein zu rücken, war Birger Gesthuisen (langjähriger Mitarbeiter beim Westdeutschen Rundfunk, die mit dem Funkhaus Europa als einzige Länderanstalt über ein Vollzeitprogramm für Migranten verfügt) ein Jahr lang im Auftrag des Landesmusikrats Nordrhein-Westfalen vom Köln-Bonner Raum über das Ruhrgebiet bis ins münsterländische Becken unterwegs. Er hat mehr als 100 Interviews mit Musikern und im Musikbereich Tätigen geführt, Amateurmusikern wie professionellen Künstlern aus 25 Ländern, die das Schlagwort Multi-Kulti mit mehr Leben erfüllen, als das gesammelte Politikergeschwätz zum Thema Integration.
Arbeitsmigranten, Studenten, Flüchtlinge und Aussiedler bilden 25% aller Einwohner NRWs. Viele haben ihre heimatliche Musik mit ins Land gebracht, die wiederum in der Diaspora vielfältige Formen annehmen konnte. Eine typische Erfahrung könnte diese sein:
Ein Landsmann von Konstantinos, der Bouzukispieler Vasilis 'Nick' Nikitakis, sollte übrigens später für uns Deutsche die anti-rassistische Hymne schlechthin verfassen, "Arsch huh, Zäng ussenander" (Kölsch für Arsch hoch, Zähne auseinander).Konstantinos Andrikopulos fand nach seiner Einreise im Jahre 1993 zunächst in diversen griechischen Restaurants eine Arbeit. Damals war er Hals über Kopf vor der griechischen Wirtschaftsmisere geflüchtet. Wie für die meisten Einwanderer begann mit seiner Ankunft ein "Crashkurs in Sachen Migration": Man fühlt sich in der Fremde wie ein kleines Kind: alles muss man von Anfang an neu gestalten, wie ein völlig neues Leben. Als ich endlich eine Wohnung gefunden hatte und auch eine Arbeitsstelle, bekam ich schließlich nichts von beidem, weil für die Wohnung die Stadtverwaltung eine Arbeitsbestätigung verlangte, und für meine Arbeit brauchte ich eine Bestätigung des Wohnungseigentümers. Vielleicht liegt es an diesen Erfahrungen, dass Konstantinos Andrikopulos später sein Ensemble "Paradoxon-Klangorchester" nannte ....
Vor seiner Auswanderung spielte griechische Musik für ihn keine besondere Rolle, nach seiner Ankunft in Bochum wurden die Klänge aus der alten Heimat zu einem kulturellen Anker. Besonders die traditionellen Lieder spendeten einen gewissen Trost, denn sie waren ihm ein vitaler Beleg, dass schon viele Menschen vor ihm eine ähnliche Situation durchlebten: Was ich damals in schwierigen Jahren erlebte, konnte ich auch in zwei oder dreihundert Jahre alten Liedern finden. Sie vermittelten mir einen großen Respekt gegenüber der traditionellen Musik.
Bei seiner Suche nach traditionellen griechischen Liedern fand Konstantinos Andrikopulos historische Tonaufnahmen von griechischen Kriegsgefangenen. Einige dieser Lieder waren in der Zwischenzeit verklungen, doch diese Aufnahmen und deren Aufbereitung retteten sie vor dem Vergessen. Konstantinos Andrikopulos dokumentiert seine Arbeit auf seiner Webseite. Aus dem "Wirtschaftsflüchtling" Konstantinos Andrikopulos wurde ein Musiker, Musiklehrer und Ensembleleiter ...
Birger Gesthuisens Reise durch die ethnischen Musiklandschaften NRWs erzählt auch von den Profis, die hier hängengeblieben sind oder auf der Durchreise Spuren hinterlassen haben. Der ghanaische Perkussionist Mustapha Tettey Addy kam beispielsweise bereits in den 1970ern nach Düsseldorf. Er war als Perkussionslehrer tätig und initiierte eine große Begeisterung für das Trommeln. Reinhard Conen schuf mit Wosso-Wosso das erste weiße Trommel-Ensemble Deutschlands und heiratete eine Verwandte Mustaphas.
Ein paar Beispiele im Schnelldurchgang:


|
Der Flamenco-Gitarrist Rafael Cortés aus Altenessen, der seinen ersten Gitarren-Unterricht in der Zeche Carl erhalten hat, fasst zusammen:
Die Gitarristen in Madrid und Sevilla hocken ständig zusammen, und dabei beeinflusst einer den anderen, ohne dass sie dies beabsichtigen. So entsteht eine gemeinsame Klangfarbe. Ich wuchs unabhängig von diesen Einflüssen auf und konnte mich eigenständig entwickeln. Meine Freunde kamen aus dem Libanon, aus Marokko, der Türkei und dem damaligen Jugoslawien. Wenn ich sie zuhause abholte, lernte ich auch deren Musik kennen.Rafael Cortés hielt sich einige Monate in Spanien auf. Sein Fazit: Ich vermisste meine Pommes mit Currywurst ...
Es gibt zudem ein breites Spektrum von Laienmusik und semi-professionellen Künstlern: polnische Arbeiterchöre mit mehr als 110jähriger Geschichte;



|
Man erfährt viel über Musik, Migrationsgeschichten, Motive der Auswanderung, Erwartungen und Wege in der deutschen Gesellschaft. Auf diesem Streifzug kann vieles nur angerissen werden, so vielfältig sind die Musikwelten in NRW.
Sehr hilfreich ist das Personen- und Ensembleregister. Dem Buch liegt zudem eine 80-minütige CD mit 28 Titeln bei. Da gibt es einen unbekannten Zymbalspieler in der Moerser Fußgängerzone zu hören, aber auch das Transorient Orchestra und die Nicolas Simion Group.
Irgendwie könnte man auch sagen, dass für Hubert von Goisern alles in NRW geendet hat. Zumindest beinahe. Die Rede ist von der Linz Europa Tour, die Hubert und seine Band auf einer zum Konzertschiff umgebauten Transport-Barge quer durch Europa führte. 2007 über die Donau ans Schwarze Meer, 2008 über Rhein-Main-Donau an die Nordsee, und als Schlusspunkt ein mehrtägiges Konzert im Hafen von Linz. Unser Ziel: Europa buchstäblich "im Fluss" zu erleben, trotz aller Grenzerfahrungen seinen Metamorphosen nachzuspüren.
An den Anlegestellen wurden Konzerte gegeben, und es spielte nicht nur Hubert von Goisern, seine junge Band und die Ganes-Mädels als Background (#42) auf, sondern auch Musiker der Anrainerstaaten wie Willi Resetarits (#40), Zdob si Zdub (#36), Haydamaky (#36), Konstantin Wecker (#37), Wolfgang Niedecken (#42), Gerd Köster (#33), u.v.m.
Es war der Wunsch der Organisatoren, dass Hubert während der Fahrt einen Weblog schreibt. Aus diesem ist nun das vorliegende Logbuch entstanden, ergänzt durch interessante Details, die z.B. bei den TV-Dokus nicht zur Sprache gekommen sind, oder Dinge, die damals nicht allzu öffentlich gesagt werden durften, um das Projekt nicht zu gefährden.
Eines Tages in Silistra, Bulgarien:
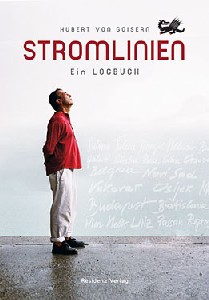 Hubert von Goisern, Stromlinien - Ein Logbuch. Residenz Verlag, 2010, ISBN 978-3-7017-3186-2, 279 S, €27,90. |
Unsere Spielstätte, eine schöne Bucht in der Nähe eines Hotels wurde inzwischen zugeschüttet. Ich fahre mit dem Beiboot das Ufer ab und entdecke einen schönen Platz. Ideal, eine Naturarena. Aufregung, es sei ausgemacht und angekündigt worden, dass wir vor dem Hotel Drustar spielen würden. Am Morgen akzeptiere ich zähneknirschend, auf die dreistufige Terrasse des am Ufer gelegenen Hotels hin zu spielen. Ich verzichte im Interesse des Friedens auf meine Platzwahl, unter der Vorausssetzung, dass die Terasse von Tischen, Stühlen und Sonnenschirmen leergeräumt und dem allgemeinen Publikum zugänglich gemacht wird.Die Terrasse ist drei Stunden vor Konzertbeginn, wie sie vorher war und von Sicherheitspersonal so abgeschirmt, dass nur Leute zugelassen werden, die bereit sind, an einem der Tische Platz zu nehmen und etwas zu konsumieren. Die vorderste Stufe ist zudem reserviert für Freunde des Hauses: mit Goldketten bekränzte Gesellen mit weiblichem Aufputz. Ich gehe ans Mikrofon und lasse alle wissen, dass das nicht akzeptabel sei, dass ich nicht bereit sei, für ein paar Reiche zu spielen, sondern ein Konzert für alle Bürger und Gäste Silistras geben werde. Das sei nicht meine Vorstellung von Europa, wo die Mehrzahl der Menschen zu Zaungästen degradiert werden.
Ich gehe zu den Technikern und sage ihnen, sie sollen sich bereithalten, alles an Bord zu bringen und abzulegen. Balou, unserem technischen Leiter, gelingt es, das Dach in Rekordzeit einzufahren, und ab geht's. Die Lautsprecheranlage donnert Roman Gregorys "Mach di bereit für dei erste Watschn heit" übers Wasser. Ich beobachte, wie uns die inzwischen über 2000 Zuschauer unter Beifallsgeschrei wie eine Prozession am Ufer folgen. Nachdem wir 'unseren' Platz erreichen, fahren wir Dach und LED-Wände hoch und beginnen zusammen mit unseren Gästen zu spielen. Getragen von einer Welle unendlicher Solidarität und Dankbarkeit für diesen Akt des Widerstands.
Nachtrag: der WWF war just an diesem Tag zu Gast an Bord und hatte Medienvertreter aus Deutschland mitgebracht. Sie bekamen wirklich etwas geboten. Darüber berichtet haben sie nichts. Vielleicht lag es daran, dass einige sturzbetrunken waren, als sie das Boot verließen.
Warum tust du dir das an?, wird Hubert von einer Dolmetscherin gefragt und er hat selbst keine klare Antwort: Das ist nicht das Europa, von dem ich träume - es ist vielleicht das Europa der Abzocker und Ausgrenzer, meines ist es nicht. Es ist notwendig dagegenzuhalten, auch wenn es anstrengend ist.
Das Reisetagebuch wird ergänzt durch stimmungsvolle Farbbilder von Land und Leuten, vom Bordleben und ein paar schönen Konzertfotos. Es sei eines der vielleicht letzten großen Abenteuer, die auf diesem Kontinent noch möglich sind, sinniert Hubert von Goisern. Das letzte Abenteuer? Für Hubert? Schau'n ma mal!
 Hubert von Goisern @ FolkWorld:
FW#19,
#23, |
Die Idee Hubert von Goiserns vorwegnehmend, absolvierte die französische Gruppe Mano Negra ihre Abschiedstournee zusammen mit der Theater-Kompagnie Royal de Luxe in einem Cargo-Schiff in Südamerika. Wie der Goiserer ist auch Frontmann Manu Chao ein musikalischer Herumtreiber, ein Getriebener.
José Manuel Thomas Arthur, wie er mit vollständigem Namen heisst, wurde 1961 in Paris geboren. Sein Vater war ein galizischer Sozialist, der 1956 mit einem Stipendium für klassische Musik Spanien verließ, Manus Mutter stammt aus dem Baskenland. Manu wuchs mit der Musik der Pariser Vororte auf: ein Gemisch von purem Rock'n'Roll, von sexy Soul, von tobendem Punk und forderndem Reggae. Sein Vorbild war Clash-Frontmann Joe Strummer (#25): aus der Punkbewegung und deren nihilistischer Wut heraus suchten sie nach anderen vielversprechenden musikalischen Stilen.
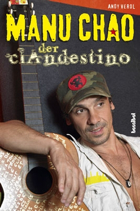 Andy Vérol, Manu Chao - Der Clandestino. Han-nibal, 2010, ISBN 978-3-85445-322-2, 191 S, €14,95. Manu @ FW: #12 |
Von 1987 bis 1995 war er Mitglied und kreativer Kopf der Band Mano Negra. Mano Negra fiel durch einen Musikstil auf, der Punkrock, Ska und Reggae mit Chansons, Salsa, Flamenco sowie anderen traditionellen Musikstilen Afrikas und Lateinamerikas bunt vermischte. Manu Chao singt in Englisch, Französisch, Spanisch, Arabisch, oft benutzt er mehrere Sprachen in einem Stück.
Über Mano Negras Debütalbum "Patchanka" urteilt der Pariser Journalist Andy Vérol:
Pachanga ist eine Mixtur aus Merengue und Conga, die in den sechziger Jahren von Eduardo Davidson in Kuba kreiert wurde. Manu Chao spielte mit dem weichen Pachanga und verlieh ihm mit dem markanten "K" einen eher rockigen Sound. So wurde die Patchanka, diese Kombination aus lateinamerikanischen Musikstilen und der schneidenden Klinge der Rockmusik, zu einem klingenden Eintopf.
Der Bandname Mano Negra - dis schwarze Hand - war einem Comic entnommen, in dem eine Bande Guerilleros mit diesem Namen vorkommt. Es gab aber auch eine italienische Mafia-artige Gemeinschaft und eine Gruppe anarchistischer andalusischer Bauern mit diesem Namen. Manu Chao erinnert sich: In Kolumbien bezeichnet es eine paramilitärische rechtsextreme Bewegung: Als sie unsere Plakate mit der schwarzen Hand auf dem roten Stern sahen, hat sie das ein bisschen aus dem Takt gebracht.
Mano Negra, eine Gruppe von Troubadour-Rockern, die permanent auf Tournee war, wurde bekannt für ihre mitreißenden und ausgelassenen Konzerte. Aber Manu Chao war überzeugt, dass Mano Negra eigentlich nur er selber sei, was zur Auflösung der Gruppe führte. Mit dem Musikkollektiv Radio Bemba, dass sich nach jeder Tour auflöst, reiste er fortan um die Welt. Der Pariser Straßenjunge wurde zum Megastar, der auf den Titel des Wall Street Journals und des Rolling Stone erschien, zum Vorbild für viele ähnliche Formationen und zu einem der Wortführer der Anti-Globalisierungsbewegung.
|
Im Gegensatz zu Manu Chao posieren Mando Diao
lieber auf Werbe-veranstaltungen für Automobilmarken und Mobilfunkanbieter.
Die Ende der 90er gegrün-dete Rockband hat die schwedische Kleinstadt Borlänge
auf die Rock-'n'-Roll-Landkarte ge-setzt (FW#37),
Heimat von Schwedens größtem Rockfestival.
(Borlänge liegt im Herzen Dalarnas, ein Zentrum schwedischer Volksmusik
-> #20,
#20.)
Zwar glauben die fünf Lümmel, mit ihrem auf Sixties- und Brit-Pop aufbauenden Garagenrock besser zu sein
als alles von The Who, den Kinks oder den Small Faces, es ist sogar eine rundere Sache als viele Alben der Beatles und Stones,
leider reicht ihr IQ zusammen-genommen nicht an den von Ray Davies heran,
von den banalen, auf ein Stück Klopapier gekritzelten Texten mal ganz zu schweigen.
Süß mögen die Jungs ja sein, aber so rebellisch wie ein BWL-Studium. Zumin-dest haben sie auf den
Rat ihrer im Sozialwesen tätigen Eltern gehört: "Ende nicht wie ich! Sieh zu, dass du ordentlich Geld verdienst!"
Ich will das schnelle Auto und das Zimmer im Fünfsternehotel, und ich will am Pool sitzen und Shrimps essen. Oder was immer es ist, was die Reichen essen.
Klaus Janke, Süße Rebellen - Die Mando Diao Story.
Hannibal,
2010, ISBN 978-3-85445-312-3, 220 S, €14,95.
|
Im Gegensatz zu vielen Leuten aus dem Westen, die sich als Weltbürger geben, hat Manu sehr schnell den Worten Taten folgen lassen. Man vergisst, dass er sich wie die meisten Künstler damit hätte zufriedengeben können, bei gigantischen Benefizkonzerten mitzumachen oder sich einige Tage im Jahr als Pate einer gemeinnützigen Organisation zu widmen. In Wirklichkeit ging Manu Chao viel weiter. Er widmete sich ununterbrochen, jahrein, jahraus den am meisten Benachteiligten der Bevölkerung jener Länder, die er bereiste. Was sich von seinen vielen Begegnungen und den Kämpfen, die seine Aufmerksamkeit beanspruchten, abzeichnete, war ein Status, der alle Clandestinos, diese Illegalen und von der Welt Ausgeschlossenen vereinte: die 'clandestinité', also die Heimlichkeit, die Illegalität.Gegner der Globalisierung, aber auch eines Begriffs wie "Weltmusik":
Manu Chao war strikt gegen eine solche musikalische Verallgemeinerung, die völlig unterschiedliche Musikstile über einen Kamm scherte und fälschlicherweise gleichsetzte. Seiner Ansicht nach diente der Begriff der Weltmusik nur dazu, viele Platten zu verkaufen; die Entdeckung und Entwicklung traditioneller Musikformen war nebensächlich. In seinen Augen hatte Bob Marley eine musikalische Revolution ausgelöst. Für ihn war Marley der Wegbereiter einer Fusion der Musikstile, und was die Anerkennung von traditioneller Musik betraf, war dessen Verdienst größer als der, der durch den Begriff der Weltmusik erreicht wurde. Für ihn bedeutete diese Musik mehr als nur ein paar Alben, die politisch korrekte Abendländer unterhalten sollte.
Vérol liefert ganz nebenbei einen Abriss der französischen Rockgeschichte ab Ende der
1970er-Jahre. Manus Privatleben ist Tabu und so erfährt man nur wenig über den Menschen
Manu Chao (der ein Kontrollfreak zu sein scheint) jenseits seiner musikalischen Karriere.
Nicht dass uns die Farbe seiner Unterwäsche interessieren würde, aber
der offenbar komplizierte Mensch wird leider nicht wirklich greifbar.
Kleiner Makel eines Buchs, das die Musik Manu Chaos und insbesonder Mano Negras
(wieder)entdecken lässt.
|
Als Bill Clinton auf dem Weg vom Dubliner Flughafen durch unsere Straße kam, war überall auf seiner Route das Parken über Nacht verboten ... Um sieben Uhr morgens wurde [ein kleiner blauer Fiat] ohne viel Federlesens entfernt, und gleichzeitig kam eine kreischende Yuppie in einem kleinen Nachthemd aus der Tür gestürzt ... Der Wind veranstaltete wunderbare Dinge mit ihrem Nachthemd. Clinton wäre gelinde gesagt entzückt gewesen.Seltener Humor - Mick zeichnet sich nicht unbedingt als witziger Autor aus. Eher durch eine tiefe Menschlichkeit, und oftmals tiefe Melancholie. Die Geschichten sind oftmals kurze Vignetten, die häufig die Perspektive wechseln und sich endlich zum Kreis schließen, wobei man keine Moral oder Pointe erwarten darf.
Ja, es ist Musik in seinen Geschichten: in der Geigenstunde wird der Reel "Christmas Eve" gespielt und das Slow Air "Blind Mary". Harfenisten, Gitarristen und Piper mögen die Melodie. Ein Soundtrack für den Kopf während des Lesens. Mein persönliches Highlight ist "Der Kreislauf des Geldes", wiederum ein Abschied, diesmal von einem 20 € Schein. Ich möchte abschließend eine Passage zitieren, die mit Musik zu tun hat: Mitten in einem Stück oder einem Lied hast du länger als sonst Blickkontakt zu einer schönen Frau. Hier läuft vielleicht etwas, denkst du. Dann kommt aus dem Nirgendwo der Typ mit dem großen Durchblick, was irische Musik angeht. Er zieht die Frau ins Gespräch und kann ihr vermutlich sogar deinen Namen und deinen musikalischen Stammbaum nennen. Wenn der Abend dem Ende entgegengeht, siehst du, wie sein Arm sich um ihre Schulter legt, und damit ist die Sache erledigt ... Der kann doch garantiert eine Note nicht von einer Zote unterscheiden, ist dein letzter Gedanke, wenn du sie zusammen weggehen siehst.Was steht da wohl im englischen Original? Mick Fitzgerald, Session - Irische Stories. Songdog, 2010, ISBN 978-3-9502890-3-9, 82 S, €12,00. |
|
Zur englischen FolkWorld |
© The Mollis - Editors of FolkWorld; Published 11/2010
All material published in FolkWorld is © The Author via FolkWorld. Storage for private use is allowed and welcome. Reviews and extracts of up to 200 words may be freely quoted and reproduced, if source and author are acknowledged. For any other reproduction please ask the Editors for permission. Although any external links from FolkWorld are chosen with greatest care, FolkWorld and its editors do not take any responsibility for the content of the linked external websites.
